Ein Film wie ein Banküberfall: chaotisch, brutal, nervös, unvergesslich. „Thunderbolt and Lightfoot“ ist einer der Streifen, die im Rückblick fast unwirklich wirken – wie ein Traum der New-Hollywood-Ära, in dem alles gleichzeitig in sich zusammenfällt und sich dann wieder erhebt. Das Regiedebüt von Michael Cimino, mit Clint Eastwood und Jeff Bridges.
Im Rückblick wird Cimino heute häufig nur noch auf „The Deer Hunter“ (1978) und „Heaven’s Gate“ (1980) reduziert – zwei Meilensteine als monumentale Wegmarken eines tragischen Aufstiegs und Falls, zwischen Oscars und totalem Bankrott. Doch hier zeigt sich schon seine Handschrift: eine Mischung aus Pathos, jeder Menge Gewalt, großer Zärtlichkeit und einem sehr amerikanischen Sinn für Landschaft und Tragik.
Was „Die Letzten beißen die Hunde“ (1974) für mich so besonders macht, ist die unwahrscheinliche Chemie zwischen Ciminos absoluter inszenatorischer Großspurigkeit und dem fast schwerelosen Spiel seines Hauptdarstellers Clint Eastwood. Der ist hier zwar eigentlich noch ganz der stoische Macho aus seinen Western und Cop-Filmen der frühen 70er, doch Cimino lässt ihn diesen Mythos endlich von innen heraus aufbrechen.
Thunderbolt – ein wortkarger Ex-Ganove mit Prediger-Pose – war tatsächlich keine Heldenfigur mehr, sondern ein Mann am Rande der Zeit, ein Relikt, das in einer post-industriellen Landschaft überlebt wie ein Phantom. Es ist heute noch faszinierend, wie Eastwood diese Rolle angenommen hat: Er hat nicht gegen sein Image angespielt, sondern es erweitert – und Risse darin zugelassen. Das sollte ihm später noch ein paar Mal in seiner Karriere gelingen.
An seiner Seite ging der Stern von Jeff Bridges auf, dem Mann, der später zum Dude werden sollte. Als Kleinganove, mit offenem Gesicht, lauter Träumen und einer noch beinahe kindlichen Wildheit. Er ist es, der den Film emotional trägt: Bridges spielt das mit Leichtigkeit, aber nie oberflächlich. Das glaube ich ihm.
Sein Lightfoot ist ein Träumer, ein Überlebenskünstler, der an etwas glaubt, das es in dieser Welt vielleicht nie gegeben hat. Er verpasst Thunderbolts Weltbild ein überfälliges Update durch eine Jugendlichkeit, die sich einfach nicht an Regeln hält. Ihre Freundschaft ist keine Bromance, sondern eher ein fragiles Band in einer feindlichen Welt – kurz, intensiv, instabil. Für mich war ganz klar: von den beiden wollte ich lieber Lightfoot sein.
Was Cimino hier gelang – ohne all das Größenwahnsinnige und Schwere seiner späteren Arbeiten – ist eine Melange aus Roadmovie, hartem Gangsterfilm und Buddy-Movie, durchzogen von einem ziemlich melancholischen Blick auf Amerika. Die Weite Montanas wurde zur Leinwand für einen Nachruf auf die USA: Tankstellen, verlassene Kirchen, rostige Schilder, als käme die Realität der 70er – und 20 Jahren Krieg in Vietnam – aus dem Off und kommentiere die Szenen mit einer großen politischen Müdigkeit. Es ist ein Film über das Ende des amerikanischen Traums, über ein letztes Aufflackern von Hoffnung, das doch wieder in Gewalt und Leere endet.
Dabei war die Handlung immer überraschend. Der Film beginnt mit einem surrealen Attentat auf einen Pastor in einer kleinen Kirche und entfaltet sich dann auf verschlungenen Wegen – wie ein Film, der selbst nicht weiß, ob er Gangsterballade oder Coming-of-Age-Geschichte sein will. Er war nicht vorhersehbar. Gerade das macht ihn spannend.
Denn Cimino hat sich schlicht geweigert, einfache Schablonen zu bedienen. Die Erzählung mäandert, nimmt sich Zeit für seltsame, manchmal fast zärtliche Momente zwischen den Figuren, und verliert nie ihr Ziel: die große, fast mythologische Wiederholung eines früheren Coups – als letzte Flucht nach vorn, als Wiedergutmachung und finale Selbstzerstörung.
Ciminos Regie war erstaunlich reif – für ein Debüt. In der Kameraarbeit (Frank Stanley) schwingt schon viel von dem mit, was später „The Deer Hunter“ visuell so eindrucksvoll machen sollte: die langsame Bewegung durch Räume, das Vertrauen auf lange Einstellungen, das Spiel mit natürlichem Licht. Doch im Gegensatz zu seinem späteren Werk hält sich „Thunderbolt and Lightfoot“ noch im Rahmen – ist formal diszipliniert und nur emotional wirklich frei. Die Gewalt kommt zwar plötzlich, und die Brüche sind scharf, sie sind es aber nie zum Selbstzweck. Und deshalb komme ich klar damit.
Eastwood, der auch Produzent war, soll Cimino angeblich total freie Hand gelassen haben – ein eher ungewöhnlicher Schritt für einen so über-kontrollierten Superstar. Doch vielleicht war es genau diese Kombination aus Eastwoods überragender Star-Power und Ciminos visionärem Hunger, die diesen Film ermöglicht hat. Der eine bringt das Fundament, der andere das Feuer. In dieser Spannung liegt ein Geheimnis des Films. Und mehr als nur ein wenig auch an George Kennedy, dem bereits Oscar gekrönten König der Nebendarsteller, der hier quasi die Rolle erfunden hat, die ihn noch Jahrzehnte später als Senior-Sidekick aller möglichen absurden Helden in Hollywood quasi unentbehrlich machen wird.
Das Ende ist, ohne zu viel zu verraten, ein Abgesang: Kein moralisches Urteil, kein großer pathetischer Abgang – eher ein stilles, bitteres Nicken in Richtung der Zuschauer:innen. Cimino glaubt nicht an Erlösung. Aber er glaubt an Figuren, die sich gegen ihren Untergang stemmen. Vielleicht ist das die eigentliche Kraft dieses Films: Seine Hoffnungslosigkeit ist nicht zynisch, sondern tatsächlich poetisch. Irgendwie.
„Die Letzten beißen die Hunde“ ist für mich inzwischen so etwas wie ein vergessener Klassiker. Ein Film, der damals wohl zu früh kam, um schon als Meisterwerk erkannt zu werden – und doch zu spät, denn so ist er zu seiner Zeit als doch noch ziemlich konservatives Werk in der Welle von New-Hollywood untergegangen. Er blieb also irgendwo in einem filmischen Zwischenraum hängen: schmerzhaft schön, voll absurder Energie, getragen von zwei fantastischen Darstellern, die zwar aus unterschiedlichen Generationen kamen, sich aber doch auf Augenhöhe begegnen konnten.
„Remember that we are all imperfect.“
Dieser Beitrag wurde zuerst veröffentlicht am 19.07.2025.
Derzeit auch bei ARTE in der Mediathek: „Jeff Bridges und „The Dude“ – Coole Aura, später Ruhm“, Doku, 2025, 55 Min, verfügbar bis 18.08.2025
Verwandte Beiträge >>
Inhaltswarnung >>
Der Film enthält explizite Darstellungen von Waffengewalt, körperlicher Misshandlung und plötzlicher tödlicher Gewalt. Zudem sind sexualisierte Übergriffe und psychische Grenzverletzungen Teil einzelner Szenen. Die raue Sprache und physische Brutalität können belastend wirken. Thematisch stehen Verrat, Misstrauen und existentielle Ausweglosigkeit im Vordergrund.
Buddy-Movie, Krimi, USA, 1974, FSK: 16, Sprachen: Deutsch/Englisch Regie: Michael Cimino, Drehbuch: Michael Cimino, Produktion: Robert Daley, Musik: Dee Barton, Kamera: Frank Stanley, Schnitt: Ferris Webster, Mit: Clint Eastwood, Jeff Bridges, George Kennedy, Geoffrey Lewis, Catherine Bach, Gary Busey, Jack Dodson, Eugene Elman, Burton Gilliam, Roy Jenson, Claudia Lennear, Bill McKinney, Vic Tayback, Dub Taylor, Gregory Walcott, Fediverse: @filmeundserien


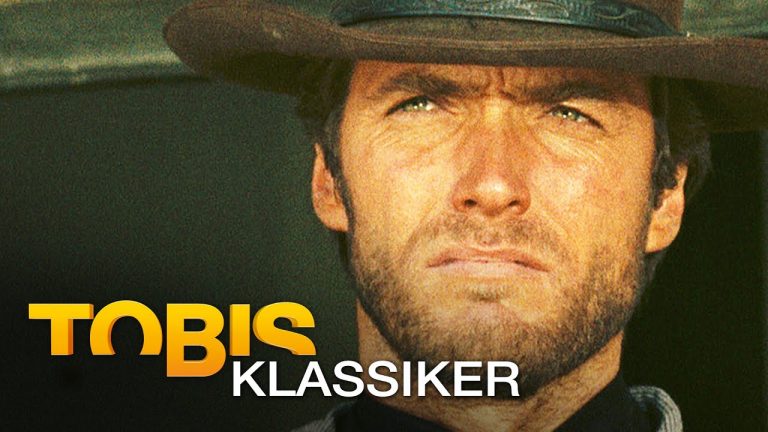


Schreiben Sie einen Kommentar