Dieser „Film“ ist ein Hammer! Einer, der den männlichen Blick nicht nur entschlüsselt, sondern zertrümmert. Eigentlich gehören diese 100 Minuten in die Grundausbildung, nicht nur für halbklug daherschwätzende Filmkritiker:innen, sondern für alle, die mit dem Medium Film – und darüber weit hinaus mit allem, was mit einer Kamera jeglicher Art aufgenommen wird – zu tun haben. Das bezieht ausdrücklich uns als Zuschauer:innen mit ein. – Also müssen Sie das sehen!
Eigentlich ist dieses „Werk“ von Nina Menkes ja kein „Film“, sondern eine Aufzeichnung einer akademischen Vorlesung, oder, neumodischer, eines Ted-Talks, der statt Powerpoint eben Filmausschnitte benutzt, um sein Thema zu vermitteln. Angereichert mit unzähligen Quellen, die nicht nur zu eben dem Thema, sondern auch und hauptsächlich für sich selbst sprechen.
Dabei arbeitet sie einen Zusammenhang zwischen etablierter Filmsprache und einer Kultur der Misogynie heraus, der jenseits der Leinwand zum Missbrauch von Frauen führt. Ihre Einzelanalysen von Szenen aus 120 Jahren Filmgeschichte entzaubern so manchen Kultfilm des Independent-Kanons – denn die patriarchal geprägte Filmsprache durchdringt nicht nur das Hollywood-Kino.
– Berlinale: Teddy Award 2022
Der Blick durch eine Kamera, da machen wir uns mal nichts vor – auch wenn es immer Ausnahmen gab, die mit der Regel gebrochen haben – war in den letzten 150 Jahren ein zutiefst männlicher. Da können wir gegebenenfalls sicher differenzieren, zwischen denen, die eine Kamera kontrollierten und denen, die dazu die Anweisungen gegeben haben. Doch um zum Punkt des Argumentes zu kommen, sind Regisseure hier auch Kameramänner. Gar nicht so selten war es auch gar dieselbe Person.
Eine Kamera schaut nicht neutral, nicht „objektiv“, sondern eben durch Jahrhunderte männlicher Regieanweisungen hindurch: ein Blick, der Aufnahmen verdichtet, kontrolliert und in einzelne Bilder auflöst. Nina Menkes demontiert eben diesen Tatbestand – sezierend, schmerzlich klar, wütend und analytisch präzise. Sie zeigt, wie tief die Bildsprache des Patriarchats im filmischen Erzählen verwurzelt ist – quer durch Genregrenzen, Jahrzehnte und auch weit jenseits eines sexualisierten Erotik- oder gar Porno-Labels.
Was den Film so bestürzend macht, ist nicht die These, sondern Menkes Methodik: Filmszenen – hunderte! – werden isoliert, eingefroren, zerlegt. Auch von mir geliebt und gefeierte Klassiker – „The Piano“, „Lost in Translation“, „Requiem for a Dream“. In fast jedem Frame ein Blick, der nicht erwidert wird, Brüste ohne Augen, Po statt Persönlichkeit. Der weibliche Körper als Bildfläche. Menkes macht diese Ikonografie sichtbar – nicht als Moralistin, sondern als Filmemacherin, die genau hinschaut und die nicht nur genau weiß, sondern auch belegt, wovon und worüber sie spricht.
Der Film lässt vor allem Frauen zu Wort kommen, deren Erfahrung mehr ist als nur eine Anekdote. Darunter Kolleg:innen wie Julie Dash, Catherine Hardwicke, Joey Soloway, Eliza Hittman und Laura Mulvey, deren Theorie des „Male Gaze“ hier mal nicht als Zitat, sondern als Ausgangspunkt fungiert.
Was folgt, ist eine visuelle Argumentation, die wirklich atemberaubend ist und schmerzhaft deutlich macht, wie eng die Ästhetik des Begehrens mit struktureller Macht, mit Casting-Couches, mit sexualisierter Gewalt verknüpft ist. Menkes lässt es aber nicht mit der rückblickenden Analyse gut sein. Sie will tatsächlich etwas verändern und fordert offensiv ein anderes Kino. Eins, das den Blick nicht von vornherein asymmetrisch aufbaut. Eins, in dem Macht und Lust nicht zwangsläufig als Hierarchie gedacht werden.
Dass der Film dabei didaktisch, fast schulisch wirkt, ist wohl seine volle Absicht – denn was hier unterrichtet wird, ist nicht politisch korrekter „Geschmack“, sondern das „Sehen“ selbst. Es geht um unbewusste Wahrnehmung, um Kameraachsen, um Lichtsetzung – und wie dadurch Macht zementiert wird. Es ist ein feministischer Crashkurs als Achterbahnfahrt in filmischer Männlichkeitskritik. Und ein unglaublich präzises Manifest, das fragt, wer eigentlich definiert, was „gute“ Bildgestaltung ist – und für wen Filme eigentlich gemacht werden.
Menkes ist wirklich radikal, weil sie systemisch denkt. Sie macht klar: Es reicht nicht, Regisseurinnen zu fördern, wenn diese dann dieselbe Mechanik der Macht bedienen. Die Dekolonisierung des Blicks beginnt für sie schon mit der Frage, was die Kamera zeigt – und was sie nicht zeigt.
Ich musste erst ein schon ziemlich alter weißer Mann werden, um all das zu lernen. Mag sein, dass ich einiges schon wusste. Instinkte sind ja auch kein:e schlechten Ratgeber:innen. Doch keine:r meiner Lehrer:innen – und darunter waren einige, die offensiv mit dem Medium Film gearbeitet haben – war in der Lage, mir diese Macht zu entschlüsseln. Darüber zu lesen, ist ein Ding. Es am Beispiel erklärt zu bekommen, ein ganz anderes.
Ganz ehrlich, #FediLZ: Wenn Sie im Bildungswesen, ganz gleich, ob mit Jugendlichen oder Erwachsenen und dem Medium Bild oder Film arbeiten, dann gibt Ihnen dieser Film einen mächtigen Werkzeugkasten, mit dem Sie die Rezeption Ihrer Schüler:innen oder Student:innen für den Rest ihres Lebens verändern könnten.
Und wenn Sie den Film nur für sich selbst schauen, dann auch ihr eigenes.
Dieser Beitrag wurde zuerst veröffentlicht am 14.07.2025.
Verwandte Beiträge >>
Inhaltswarnung >>
Der Film zeigt zahlreiche Ausschnitte aus Werken mit sexualisierter Gewaltdarstellung, voyeuristischen Kameraeinstellungen und expliziter Objektivierung von Frauenkörpern. Diese Szenen dienen der filmischen Analyse und werden ausführlich kommentiert, können aber dennoch retraumatisierend wirken.
Dokumentarfilm, USA, 2022, FSK: ab 18(?), Regie: Nina Menkes, Drehbuch: Nina Menkes, Produktion: Tim Disney, Maria Giese, Kamera: Shana Hagan, Schnitt: Cecily Rhett, Mit: Nina Menkes, Joey Soloway, Julie Dash, Catherine Hardwicke, Eliza Hittman, Laura Mulvey, Rosanna Arquette, Charlyne Yi, Penelope Spheeris, Nancy Schreiber, Amy Ziering, Fediverse: @filmeundserien


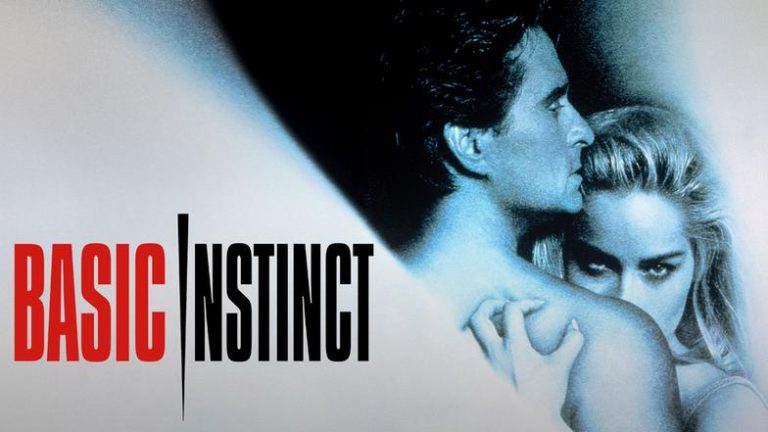





Schreiben Sie einen Kommentar