Der Schwede hatte eine Hand für die Literatur. Für große Erzählungen. Romane, die auf der Leinwand ein ganz eigenes Leben bekamen. Geschichten von Menschen, die den großen Fragen des Lebens gefolgt sind. Wer bist du? Warum bist du hier? Was macht das mit dir?
Ich hatte eine Phase in meinem Leben, zu der Hallströms Filme unbedingt dazu gehörten. „Mein Leben als Hund“ (1986) war noch ein kleines Erlebnis, in einem ebenso kleinen Essener Programmkino. Die Geschichte des Jungen in einem kleinen Dorf in Småland, war eine fast logische Fortsetzung der Geschichten der wundervollen Astrid Lindgren, wer hat sie denn nicht geliebt, als Kind und dann ein ganzes Leben lang? Nur folgerichtig, dass Hallström eben auch zwei Filme aus ihren Geschichten aus Bullerbü machen würde. Da kann ein Schwede eben seiner Identität auch nicht entkommen.
Als er dann nach Amerika gegangen ist, da ging ich natürlich mit. Und „Irgendwo in Iowa“ (1993) haben wir uns in einem Diner wiedergetroffen. Johnny Depp ließ die Kartoffeln tanzen und ein noch ganz junger Leonardo DiCaprio klettert auf einen Wasserturm, der damit zu einer Ikone des Weltkinos wurde – und eigentlich gar nicht in Iowa, sondern in Texas steht.
Natürlich steckt in fast jedem Film derselbe große Schwindel. Die Orte, die wir sehen, sind nicht wirklich die, von denen uns die Geschichten erzählen. Es kommt eben darauf an, wie sehr wir den Kulissen glauben wollen, dass die Menschen, die sie bevölkern, tatsächlich in ihnen leben.
Für die „Schiffsmeldungen“ (2002) nach dem Roman und Welterfolg von E. Annie Proulx, wurden für Hallström dann die Kulissen fast ein Jahrzehnt später genau dort gebaut, wo die Geschichte spielt, auf Neufundland, einer Insel, draußen im Sankt-Lorenz-Strom, wo ein Sommer nur wenige Tage dauert und der Atlantische Ozean die Lebensbedingungen diktiert.
Warum schlagen Menschen dort Wurzeln und das über mehrere Generationen? Was bindet Sie an den Ort? Und wie sehr definiert der Ort, wer sie sind und wie sie leben?
Ich habe den Roman verschlungen. Alles, was „nordisch“ ist, findet bei mir sowieso einen dankbaren Rezipienten. Und wenn Sie sich einmal von Süden nach Norden durch Skandinavien geschlagen haben, dann hat die Reise von Hallström von Småland nach Neufundland auch einen ganz eigenen Sinn. Ich habe es in Kanada nur bis Montreal geschafft, doch ich war mal in Tromsø (Norwegen) und wollte eigentlich auf die Lofoten. Aus diesen Plänen wurde nichts. Das Wetter hat 3 Tage lang unsere Überfahrt verhindert.
Das war jetzt ein ziemlich unnötiger Ausflug in meine Reisetagebücher, bitte vergeben Sie mir. Doch lasse ich mich von Ortserzählungen eben mitreißen und vergleiche diese mit den Orten, die ich selber kenne. Und weil der Ort „Killick-Claw“ in Proulx‘ Roman ein fiktiver ist, kann er eben eigentlich doch überall sein.
Die Geschichte des Romans ist zutiefst dramatisch. Missbrauch und Misshandlung haben in den Biografien der Menschen eine tiefe Spur der Verletzungen hinterlassen. Schwer-Verwundete, körperlich, seelisch, auf die eine oder andere Weise, sind sie alle.
Obwohl mit Kevin Spacey und seinem Quoyle ein Mann im Zentrum dieser Geschichte steht, sind es, nach Quoyles Kindheitstrauma vermittelt durch seinen Vater, die Frauen seines Lebens, die dieses Leben formen. Von Julianne Moore, Judi Dench und Cate Blanchett, werden diese Frauen so lebensecht verkörpert, dass wir die Darstellerinnen zwar noch wiedererkennen – jede für sich ein Superstar – aber ihre Figuren auch ebenso Personen aus unserem eigenen sozialen Netzwerk, unserer eigenen Nachbarschaft, unserem eigenen Leben sein könnten, deren Geschichten wir sehen.
Im Grunde sind es ihre Geschichten, die der vergewaltigten, verlassenen, verlorenen Frauen, für die Quoyle der eine Punkt ihrer Lebenslinien ist, an welchem sie sich treffen.
Wie können so verwundete, beschädigte Menschen an einem Ort überleben, dessen Bedingungen an die Grenzen dessen gehen, was die Natur uns noch als eben bewohnbar zugesteht. Warum entscheiden sie sich ausgerechnet für diesen Platz in der Welt? Ganz normale kleine Leben, in jeder Dimension ihres Daseins, jenseits dessen, was die meisten von uns sich vorstellen können oder ertragen würden.
Am Ende des Filmes, wenn der Atlantik-Sturm sich die Ruinen der Vergangenheit geholt hat, gibt er etwas Neuem eine Chance. Liebe und Solidarität sind die Gründe dafür, an diesem einen Ort zu bleiben.
„Building a future.“
Drama, USA, 2002, FSK: ab 12, Regie: Lasse Hallström, Drehbuch: Robert Nelson Jacobs, Annie Proulx, Produktion: Rob Cowan, Linda Goldstein Knowlton, Leslie Holleran, Irwin Winkler, Musik: Christopher Young, Kamera: Oliver Stapleton, Schnitt: Andrew Mondshein, Mit: Kevin Spacey, Julianne Moore, Judi Dench, Cate Blanchett, Pete Postlethwaite, Scott Glenn, Rhys Ifans, Gordon Pinsent, Jason Behr, Alyssa Gainer, Kaitlyn Gainer, Lauren Gainer, Will McAllister, Katherine Moennig, Fediverse: @filmeundserien
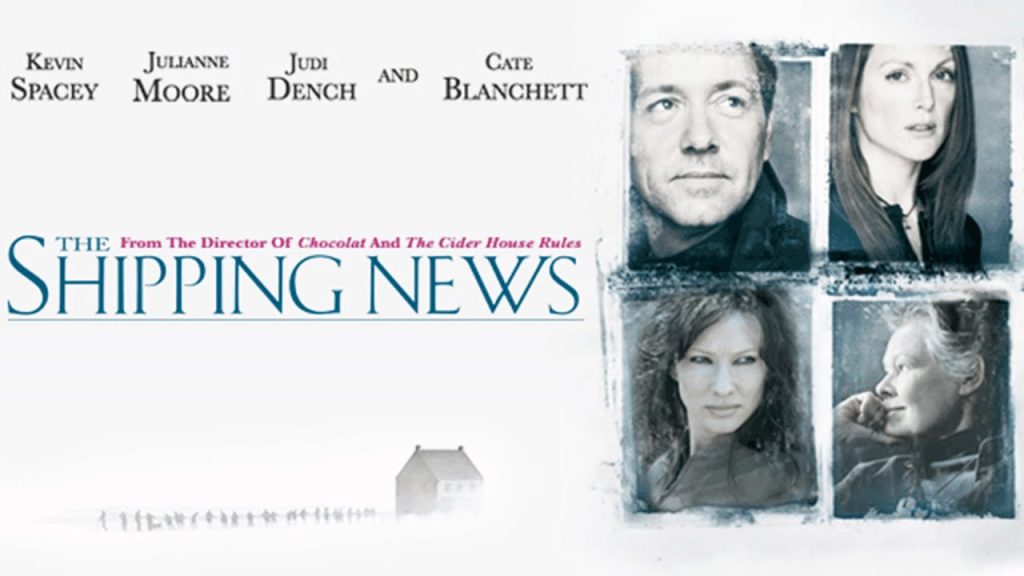


Schreiben Sie einen Kommentar